Güllebehandlung durch Pflanzenkohle
von Hans-Peter Schmidt
Zur Druckausgabe im PDF-Format
Im Frühjahr und Herbst, wenn Bauern ihre Felder mit Gülle tränken, liegt ein beißender Gestank über dem Land. Der stechende Geruch stammt vor allem vom Ammoniak, einer leicht flüchtigen Stickstoffverbindung, die aus dem in der Gülle enthaltenen Harnstoff gebildet wird. Das Ammoniak, welches auf Bodenorganismen und Feinwurzeln ätzend wirkt, entweicht zu großen Teilen in die Atmosphäre, wo es sich an Staubpartikel bindet und schließlich in Form von saurem Regen wieder auf Felder, Wälder, Städte und Gewässer niedergeht und dadurch hohe Umweltschäden verursacht.
Während ein Teil der in der Gülle enthaltenen Mineralstoffe wie Ammonium, Nitrat, Harnstoff und Phosphat den Pflanzen als Nährstoffe zur Verfügung stehen, wird neben den klimaschädlichen Ausgasungen ein erheblicher Teil der Nährstoffe in Grund- und Oberflächengewässer ausgewaschen. Insgesamt gehen durch Ausgasung, Auswaschung und Erosion auf dem Weg vom Stall über die Güllegrube bis zum Boden rund 50% des Stickstoffs verloren, was nicht nur für eine sehr geringe Düngeeffizienz spricht, sondern hohe Folgekosten durch Umweltschäden verursacht. So kommt es allein in Deutschland zu landwirtschaftlichen Ammoniakemissionen von über 600 000 Tonnen pro Jahr.
Aufgrund der Ausgasung von Ammoniak und des Auswaschens von Nitraten kommt es durch die Düngung mit unbehandelter Gülle zudem zu Bodenversauerung, was die Fruchtbarkeit und biologische Aktivität des Bodens stark beeinträchtigt und den Abbau von Humus beschleunigt.
Noch gefährlicher als die Bodenversauerung ist allerdings, dass durch nicht hygienisierte Gülle Krankheitserreger sowohl aus dem Verdauungstrakt der Tiere als auch von den in der faulenden Güllegrube herangezüchteten Bakterienstämmen und Pilzsporen auf die Felder ausgebracht werden. Zwar werden die meisten krankheitserregenden Mikroorganismen durch Antagonisten im Boden vernichtet bzw. abgebaut, doch einige hochresistente Bakterienstämme, Pilzsporen und sonstige Krankheitserreger wie z.B. Clostridien (Ehec, Botulismus …) überleben den gesamten Wachstumszyklus der Pflanzen und können über das von diesen Feldern eingebrachte Futter wieder von den Tieren aufgenommen werden. Auf diese Weise schließt sich ein teuflischer Kreislauf, der nach und nach immer resistentere Krankheitserreger heranzüchtet und die Gesundheit von Tier und Mensch gefährden kann.
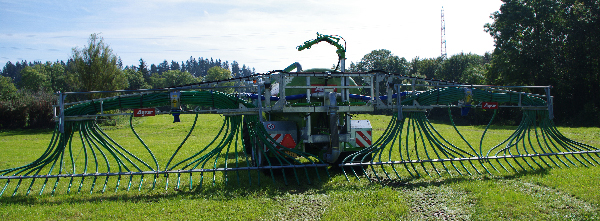
Was stinkt in der Gülle?
Der überwiegende Anteil des Stickstoffs in der Gülle liegt in Form von Harnstoff vor. Durch die Aktivität des Enzyms Urease wird Harnstoff in Ammoniak und CO2 (bzw. zu Ammonium + CO3) umgewandelt. Das Enzym Urease befindet sich sowohl im Tiermagen als auch in der Güllegrube und im Boden, so dass der Abbauprozess des Harnstoffs quasi kontinuierlich ablaufen kann. Während im Boden die Umwandlung in den wichtigen Pflanzennährstoff Ammonium erwünscht ist und überhaupt erst die Düngewirkung ermöglicht, bedeutet die Umwandlung in der Güllegrube den Verlust des Stickstoffs und nicht zuletzt den beißenden Gestank.
Güllebehandlung durch Milchsäuregärung
Um Gülle zu hygienisieren sowie die Nährstoffe zu stabilisieren und dadurch auch die Geruchsentwicklung zu verhindern, müssen
- die flüchtigen Nährstoffe gebunden,
- das Enzyme Urease gehemmt und
- die Vermehrung krankheitserregender Mikroorganismen verhindert werden.
Zur Stabilisierung des Harnstoffes in der Gülle und zur Verhinderung von Fäulnis eignet sich insbesondere die Milchsäuregärung, ein im Grunde sehr altes Konservierungsverfahren. Bei der Milchsäuregärung werden Zuckverbindungen, wie sie in allen pflanzlichen Stoffen und in geringeren Konzentrationen auch in der Gülle vorkommen, durch Milchsäurebakterien in Milchsäure umgewandelt. Die Umwandlung zu Milchsäure führt zur Absenkung des pH-Werts auf 3,5 – 4,5. Es entsteht ein stark saures Milieu, das den meisten Bakterienarten, Sporenbildnern und Enzymen die Überlebensbedingungen entzieht.
Die Verhinderung von Fäulnis und Ausgasung ist allerdings nicht allein eine Frage der Säure, denn sonst könnte man jede beliebige Säure zur Absenkung des pH-Wertes verwenden. Es ist von großer Wichtigkeit, dass das saure Milieu durch Milchsäurebakterien entsteht, da auf diese Weise die in der Gülle verbliebenen Zuckerverbindungen abgebaut werden, wodurch konkurrierenden Fäulnisbakterien die Nahrungsgrundlage entzogen wird und sie sich nicht mehr vermehren können.
Hinzu kommt, dass in den Zellen der sich rasant vermehrenden Milchsäurebakterien wertvolle Zellbausteine wie Stickstoff, Phosphor, Schwefel und Kohlenstoff eingelagert werden. Stickstoff, Phosphor und Schwefel, die im Zellgewebe von Milchsäurebakterien gespeichert werden, sind biologisch gebunden und damit eben nicht mehr flüchtig. Konkurrierenden Mikroben werden damit alle wichtigen Nährstoffe verknappt und es entsteht ein für sie ungünstiges, saures Milieu.
Wenn die Milchsäurebakterien später mit der stabilisierten Gülle auf den landwirtschaftlichen Boden kommen, werden ihnen durch Luftsauerstoff und höhere pH-Werte des Boden dann ihrerseits die Überlebensbedingungen entzogen, wodurch die in ihren Zellen gespeicherten Nährstoffe von anderen Mikroben rezykliert und pflanzenverfügbar werden. Ein dann wirklich biologisch aktivierender Dünger.
Historische Bedeutung der Milchsäuregärung
Milchsäuregärungen wurden bereits in der Steinzeit zur Konservierung von Lebensmitteln verwendet und waren Vorraussetzung dafür, das eine Vorratswirtschaft entstehen konnte, was wiederum Vorraussetzung für die Bildung sesshafter Gesellschaften war. Man nutzte die Milchsäuregärung zur Herstellung von Sauerkraut, Sauerteigbrot, Joghurt, Wurst, Wein und auch für Futtersilage. Zur Güllefermentierung wurde die Milchsäuregärung allerdings kaum eingesetzt, da in traditionellen Stallanlagen keine Nassgülle entstand und der Festmist besser kompostiert als fermentiert wird.
Rezept zur Güllebehandlung mit Sauerkrautsaft und Pflanzenkohle
Um sich der Milchsäuregärung zur „Konservierung“ von Gülle zu bedienen, muss die Güllegrube als erstes mit einer ausreichenden Anzahl von Milchsäurebakterien geimpft werden. Die Milchsäurebakterien müssen dann so vermehrt werden, dass der pH-Wert auf unter 4,5 sinkt. Folgendes Vorgehen hat sich in der Praxis bewährt:
- Ausleeren der Güllegrube, so dass nicht mehr als 25 cm Bodensatz übrig bleiben
- Die in der Grube verbleibende Restgülle mit 0,2 – 0,5 % Sauerkrautsaft animpfen
- Zur Vermehrung der Milchsäurebakterien 1 % Melasse hinzugeben
- Zur Fixierung von Nähr- und Giftstoffen 2 % Pflanzenkohle einmischen
(auf 50 m3 Restgülle entspricht dies 100 – 250 l Sauerkrautsaft, 500 Liter Melasse und 1 m3 Pflanzenkohle)
Sauerkrautsaft enthält eine sehr hohe Anzahl von Milchsäurebakterien und eignet sich hervorragend zum Animpfen. Anstatt Sauerkrautsaft kann aber auch Brottrunk, Silagesaft oder EM-A (effektive Mikroorganismen) verwendet werden. Letzteres enthält auch noch andere den Prozess günstig beeinflussende Mikroorganismen. Sauerkrautsaft ist allerdings das mit Abstand billigste Mittel und von der Qualität her als sehr sicher einzustufen. Heutzutage werden Millionen Liter Sauerkrautsaft kostenpflichtig von Kläranlagen entsorgt. Der agronomische Einsatz von Sauerkrautsaft wäre also zudem auch ein gutes Beispiel für die Schließung wichtiger Stoffkreisläufe.
Die Melasse wird benötigt, damit sich die im Sauerkrautsaft enthaltenen Milchsäurebakterien tausendfach vermehren können und somit das mikrobielle Milieu der Gülle optimal einstellen. Wenn die Güllegrube zu voll ist, gelingt es nicht, das mikrobielle Milieu von Fäulnis auf Milchsäuregärung umzustellen, da andere mikrobielle Stämme zu dominant sind und die Milchsäurebakterien sich trotz Melasse nicht durchsetzen können. Es ist daher unbedingt nötig, die Grube vor der Initierung der Milchsäuregärung möglichst leer zu pumpen.
Sobald der pH-Wert der Gülle durch die Milchsäuregärung unter 4,5 sinkt, wird die Umwandlung von Harnstoff zu Ammoniak unterbunden. Fäulnisbakterien werden unterdrück. Die Gülle hört auf zu stinken, die Nährstoffe bleiben erhalten und werden fixiert.
Wirkung der Pflanzenkohle
Pflanzenkohle bindet durch ihre hohe spezifische Oberfläche sehr effizient Ammonium und Ammoniak sowie andere geruchsintensive, oft toxische Stoffe. Aus diesem Grund zeigt der Einsatz von Pflanzenkohle auch ohne Milchsäuregärung bereits eine rasche Wirkung. Durch die Pflanzenkohle kann der überwiegende Teil des Güllestickstoffs pflanzenverfügbar gespeichert werden. Die Auswaschung der Gülle-Nährstoffe im Boden wird deutlich gebremst, was nicht nur das Grundwasser schützt, sondern insbesondere der Versauerung des Bodens vorbeugt. Die mit Pflanzenkohle behandelte Gülle fördert die Bodenaktivität und den Humusaufbau. Anstatt die Böden durch toxisch wirkende Gülle auszulaugen, werden die Böden langfristig aufgebaut. Insgesamt lässt sich durch den Einsatz der Pflanzenkohle die Düngewirkung der Gülle nahezu verdoppeln.
Auch wenn bereits die alleinige Behandlung der Gülle mit Pflanzenkohle deutliche Wirkung zeigt, empfiehlt sich die oben beschriebene Kombination mit der Milchsäuregärung, da nur durch die Milchsäuregärung eine Hygienisierung der Gülle erfolgt und krankheitserregende Keime abgetötet werden.
Güllebehandlung über das Jahr
Um das mikrobielle Milieu in der Güllegrube zu erhalten, muss die täglich hinzukommende Gülle jeweils mit Milchsäurebakterien geimpft werden. Dies kann dadurch geschehen, dass ca. 0,1 % bezogen auf die Menge der täglichen Frischgülle an Sauerkrautsaft und Pflanzenkohle in die Grube eingemischt werden. Am wirkungsvollsten ist es allerdings, wenn der Sauerkrautsaft durch automatische Verneblung direkt im Stall ausgebracht wird. Auf diese Weise wird bereits im Stall für ein gesundes mikrobielles Milieu gesorgt, was nicht nur der Gülle, sondern vor allem dem Vieh und den im Stall arbeitenden Menschen zu Gute kommt.
Bereits nach wenigen Tagen ändert sich das Stallklima. Es riecht nicht mehr unangenehm, das Vieh wird merklich ruhiger, entzündete Euter und Hufe schwellen ab. Die Verneblung im Stall kann vollautomatisch erfolgen, wobei aller 4 Stunden je 2 Liter Sauerkrautsaft pro 100 Großvieheinheiten im Stall vernebelt werden sollten.
Pflanzenkohle in Silage und Fütterung
Auch die Pflanzenkohle sollte so früh wie möglich im Stallbereich zum Einsatz kommen. So kann die Pflanzenkohle bereits zur Silierung von Futtermitteln in den Prozess eingeführt werden. Pflanzenkohle fördert eine saubere Milchsäuregärung der Silage und verhindert Fehlgärungen. Durch die Pflanzenkohle entstehen weniger Essigsäure und insbesondere weniger Buttersäure bei der Silierung, wodurch das Risiko von Clostridien-Befall reduziert wird. Die Gefährdung durch Pilzbefall der Silage und den damit zusammenhängenden Mycotoxinen geht zurück. Die Pflanzenkohle hat eine sehr hohe Wasserspeicherfähigkeit, was insbesondere bei ungenügender Anwelkdauer (z.B. durch schlecht Witterung) und zu geringen Trockenmasse-Konzentrationen eine gute Gärqualität gewährleistet und die Produktion von Buttersäure verhindert.
Insgesamt wird durch die Feuchtigkeitspufferung die Haltbarkeit verbessert. Dank der Pflanzenkohle kommt es kaum zur Bildung von Gärsäften, die wegen der Bildung von Buttersäure gefürchtet sind.
Die Pflanzenkohle fixiert Pestizide und Schwermetalle, die mit der Biomasse in die Silage gelangen und sowohl dort das Gärungsmilieu negativ beeinflussen als auch später zu toxischen Belastungen der Tiere führen. Im fertigen Silagefutter führt die Pflanzenkohle zur Verbesserung der Verdauung und höherer Energieumsätze aus der Nahrung.
Beim Einsatz von Pflanzenkohle in der Silierung darf nur Pflanzenkohle eingesetzt werden, die als Futterzusatzmittel registriert und von einem anerkannten Futtermittelhersteller produziert wurde. Pflanzen- und Holzkohle werden übrigens schon seit der frühen Eisenzeit als Futterzusatzmittel eingesetzt, um die Verdauung insbesondere von Wiederkäuern zu regulieren. Durch die Pflanzenkohle erhöht sich die Futtereffizienz, die Energieleistung der Tiere wächst, Giftstoffe werden gebunden, das mikrobielle Milieu im Verdauungstrakt stabilisiert sich. Als Futtermittel zertifizierte Pflanzenkohle kann mit 0,5% direkt dem Futter zugemischt werden. Um dem Risiko einer Blockierung essentieller Nährstoffe vorzubeugen, sollte die Fütterung von Pflanzenkohle aller 14 Tage für mindestens 5 Tage ausgesetzt werden.
Zusammenfassung
Der kombinierte Einsatz von Pflanzenkohle und Milchsäurebakterien führt zur Verbesserung der Tiergesundheit und ihrer Produktionsleistung, stabilisiert das Stallklima, hygienisiert den Stall und die Gülle, verhindert Nährstoffverluste und Klimagasemissionen und führt schließlich zu einer biologisch effizienten Düngung der landwirtschaftlichen Böden. Pflanzenkohle ist kein Wundermittel, aber in Ergänzung zur guten landwirtschaftlichen Praxis kann es die Prozesse nachhaltig optimieren, die Wirtschaftlichkeit der Betriebe erhöhen und die Umweltbilanz positiv gestalten.


Soso
03.10.2011 15:45
Ich danke für diesen wegweisenden Artikel, der aufzeigt, wie Pflanzenkohle nachhaltig in einen landwirtschaftlichen Stoffkreislauf integriert und so akute Probleme wirkungsvoll gelindert werden können.
Dennoch möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich beispielsweise bei der im Artikel gezeigten Hühner-Bodenhaltungs-Anlage keinesfalls um eine Form nachhaltigen Wirtschaftens handelt! Und genau da liegt vielleicht auch die lang gesuchte Schattenseite der Pflanzenkohle: Probleme konventioneller, nicht nachhaltiger Landwirtschaft werden durch ihren Einsatz derartig gelindert, dass ein landwirtschaftlicher Paradigmenwechsel, die "Agrarwende" augenscheinlich weniger notwendig wird! Die nachhaltige Nutzung von Pflanzenkohle und Milchsäure findet auf dem bäuerlichen Acker oder im Garten statt, ganz sicher aber nicht in profitorientierten industriellen Groß(mast)betrieben!
hps
04.10.2011 20:17
Sehr geehrte Frau Schnee,
haben Sie vielen Dank für Ihren wichtigen Kommentar, der uns an einem ganz heiklen Punkt trifft. Sie haben ganz recht, dass je mehr wir helfen, die wundesten Punkte der industriellen Landwirtschaft zu lindern, desto mehr verlängern wir auch die untragbaren Zustände derselben.
Die größten Effekte der Pflanzenkohle werden dort erzielt, wo der Boden, der Stall oder die Gülle am schlechtesten sind. In einem wirklich nachhaltigen System braucht es die Kohle eigentlich nicht. Doch die industrielle Landwirtschaft ist ein Kennzeichen der modernen Gesellschaft und lässt sich ebenso wie die moderne Gesellschaft nicht von heute auf morgen revolutionieren. Um Veränderungen zu bewirken, braucht es immer wieder einen Pakt mit der teuflischen Vernunft bzw. Pragmatik. Wenn das Leiden der in Massenzucht gehaltenen Tiere gelindert wird, weil sie nicht mehr in den Abgasen ihrer toxischen Abfälle leben, kommt dies doch den Tieren zu Gute, auch wenn die Zulassungspraxis der Massentierhaltung dadurch womöglich Verlängerung findet.
Trotzdem, wenn der Düngemittel- und Pestizideinsatz um 50% reduziert werden kann, bedeutet dies für die Umwelt das Gleiche, als wenn 50% der Betriebe auf Bio umstellen. Ersteres ist realistisch, zweiteres leider noch nicht. Und aus diesem Grund arbeiten wir in der Beratung immer häufiger auch für konventionelle Betriebe, die ihre Umweltbelastung reduzieren wollen, auch wenn sie noch nicht die betriebswirtschaftliche Möglichkeit sehen, ganz auf Bio umzustellen.
Mit freundlichen Grüssen, Ihr Hans-Peter Schmidt
greenwolf
04.10.2011 21:10
Sehr geehrter Herr Schmidt,
ich bewundere nun seit knapp einem halben Jahr ihr Engagement im Bereich der Pflanzekohle und kann nur sagen: "weiter so!". Lediglich mit einer korrekten Aufklärung kann Wissen weitervermittelt werden. Daher aus Eigeninteresse folgende Fragen an Sie: Wäre es nicht ausreichend die empfohlene Menge Pflanzenkohle an die Tiere zu verfüttern, sodass diese in den Kreislauf gelangt? Oder schwindet die Wirkung für die Gülle mit dem Verdauungsvorgang?
hps
04.10.2011 21:18
Was die Behandlung der Gülle und damit des Bodens betrifft, wäre der Einsatz in der Tiernahrung und sogar im Heu bzw. der Silage das Beste. Bedenken habe ich nur, ob eine kontinuierliche Futtergabe auch für die Tier wirklich empfehlenswert ist, da die Kohle ja nicht nur Schadstoffe, sondern auch sonstige wichtige Nährelemente im Verdauungstrakt fixieren könnte. Aus diesem Grund empfehlen wir auch, die Futterzugabe von Pflanzenkohle aller zehn Tage wenigstens für 5 Tage auszusetzen. Dies zumindest so lange, als verlässliche Langzeitstudien vorliegen, an denen allerdings schon gearbeitet wird.
greenwolf
05.10.2011 16:39
Okay in punkto Nährstofffixierung gebe ich Ihnen recht. Aber wäre es nicht ausreichend die hinzugefütterte Menge anstatt der von Ihnen beschriebenen 0,5 % auf sagen wir 0,2 % zu reduzieren, so sollten abzüglich einiger Verluste mindestens die 0,1 % in der Gülle enthalten sein. Man könnte die Pflanzenkohle kontinuierlich hinzufüttern - so haben Tier und Boden gleichzeitig etwas davon.
FJL
08.10.2011 15:30
Nach stundenlangen Recherchen zu dem Thema war ich heilfroh hier einige wirklich wichtige und scheinbar auch neutrale Informationen gefunden zu haben. Vielen Dank für diese gelungene Zusammenfassung zum Thema. Ich denke und hoffe, das Pflanzenkohle nicht nur den konventionellen sondern auch uns ökologisch arbeitenden Landwirten und Gärtnern hilft. Nicht jeder hat einen schweren Boden. Wir mit unseren leichten Sandböden und der höheren Auswaschungsgefahr, dazu den auch im ökologischen Landbau doch sehr intensiven Fruchtfolgen und hohen Nährstoffbedürfnissen bei z.B. Tomaten, Gurken etc. im Unterglasanbau, würden uns sehr freuen, wenn es auch bei uns eine Wirkung gäbe.
Ich für meinen Teil finde das Thema jedenfalls sehr sehr spannend und freue mich über alle wissenswerten Infos. Weiter so!
Helga Bucheli
18.10.2011 15:22
Ich fände es wichtig würden die Bauern mit einem Massentierhaltungsbetrieb mehr tun gegen die "Umweltverpestung".Das müsste eventuell die Tierfutterlobby propagieren oder verknüpft als Bedingung für die Subventionen.
Anstatt das Finanzieren von Maschinenparks.
Ich esse deshalb kein Fleisch aus solchen Betrieben, die Konsumenten sollten mehr Verantwortung übernehmen.
Henning Knutzen
23.10.2011 02:06
Moin moin aus Schleswig Holstein,
wir haben vor allem im Norden Deutschlands erhebliche Probleme mit dem chronischen Botulismus. Ich bin selbst Biolandwirt, betreue einige Betriebe und gebe Seminare, um die Kollegen zur Selbsthilfe zu animieren. Meiner Erfahrung nach macht die Fütterung von Milchsäure und Pflanzenkohle, sowie die Konservierung von Silagen damit, in den betroffenen Beständen großen Sinn.
In den beroffenen Beständen versuchen wir jedoch das Gesamtmilieu zu ändern. Wir verhindern die Vermehrung der Fäulniskeime, indem wir Fäulnis vermeiden und Rottevorgänge fördern. Sehr gute Erfahrungen haben wir durch Einsatz von Komposttee mit aktivierter Kohle in Verbindung mit Steinmehl und Quarzmehl gemacht (Vernebeln und an die sehr kranken Tiere direkt verabreichen). Am besten funktioniert die Aktivierung über eine Humusmühle. Pflanzenkohle und Steinmehl binden Toxine (Aktivkohle- und Heilerdewirkung). Wir wissen das Clostridien sauerstofffliehend sind, daher müssen wir Sauerstoff in die Stallungen und die Güllebehälter bringen und gleichzeitg mit antagonistischen Mikroorganismen arbeiten, die während der Kompostierung entstehen.
Im Sauerkrautsaft entstehen allerdings keine antagonistisch wirkenden Pilze, daher wäre es unlogisch zu versuchen, die Gülle so zu konservieren, da die meisten Güllebehälter ja sowieso offen sind. Eine mit Luftsauerstoff behandelte Rottegülle stinkt überhaupt nicht. Der Zusatz von Pflanzenkohle und Steinmehl ist in der Gülle sehr vorteilhaft. Auf meiner Webseite www.hamhamgmbh.de hat der Journalist Otto Schöwing einen Film darüber veröffentlicht. Man kann dort auch ein von mir verfasstes Konzept zur Umstellung eines landwirtschaftlichen Betriebes auf nachhaltige Humuswirtschaft herunterladen.
Denn das eigentliche Problem liegt in den Böden, weil durch den intensiven Humusabbau die antagonistisch wirkende sauerstoffliebende Mikroflora ausgestorben ist. Die anaerobe abbauende Mikroflora ist allerdings meistens noch da und außerdem haben wir immer mehr Fäulniserscheinungen in unseren Böden, wodurch krankmachende Clostridien sich vermehren können.
Mir sind Böden bekannt, auf denen die Landwirte spritzen können, was sie wollen. Trotzdem ist das Getreide zur Ernte schwarz und mit Mycotoxinen (DON etc.) schwerst belastet. Auf Clostridien wird dieses Korn nicht untersucht, es gelangt aber möglicherweise als Kraftfutter in den Tiermagen und kann so unsere Tierbestände infiziern. Was passiert denn mit Kot aus Geflügelmastställen? Könnte gentechnisch verändertes Futter die Mikrobiologie durcheinander bringen? Ist vielleicht Glyphosat das Problem oder eventuell die Agragasanlagen? Klärschlamm, Gärreste und Fäulnisgülle überfluten den Boden mit Fäulniskeimen. Daher ist auch das Einschlitzen von Gülle in den Boden eine Fehlentwicklung.
Das Clostridienproblem ist von führenden Bodenforschern vorausgesehen worden. Sowohl Annie France-Harrar (Humus, 1957), als auch Gustav Rhode und Erhard Hennig und sogar Justus von Liebig (1872) haben die heutige Situation beschrieben. Humus ist ein Reinboden, es gibt dort keine krankmachenden Mikroorganismen. Mir liegt eine Studie von 1920 vor, in welcher der chronische Botulismus durch verseuchte Silage beschrieben und untersucht wurde. Heute spricht man amtlicherseits von einer Faktorenkrankheit und fordert weiteren Forschungsbedarf. Es wird behauptet, das bestimmte Faktoren (schlechtes Management etc.) die Ursache sei. Es wird dabei versucht dieses Problem möglichst nicht als Tierseuche darzustellen. Denn es könnten sonst Regressforderungen seitens der Landwirte entstehen. Wir Landwirte müssen jedoch dringend handeln und nicht auf langfristige Studienergebnisse warten.
Ich fordere jeden Landwirt auf mehr über seinen Boden nachzudenken, seinen gesunden Menschenverstand einzusetzen und in seinem Herzen die Ehrfurcht vor der Natur wieder zu entdecken. Wir sollten wieder Verantwortung für unsere Ackerscholle und unsere Tiere übernehmen und entsprechend handeln. Humuswirtschaft und Terra-Preta-Technologie ist der Schlüssel dazu.
Dip.Ing.Agr. und praktischer Biobauer
Henning Knutzen
hps
23.10.2011 08:30
Salut Henning, hab besten Dank für Deinen ausführlichen Kommentar und eindringlichen Aufruf. Ich stimme Dir voll und ganz zu, dass es vor allem um die Verhinderung von Fäulnis geht. Um Fäulnis zu umgehen, gibt es immer zwei Möglichkeiten: 1. durch eine gezielte aerobe Rotte (kompostieren) oder 2. durch eine gezielte Fermentierung (bokashieren). Meiner Erfahrung nach lassen sich in fast allen Situationen beide Möglichkeiten alternativ einsetzen, so dass es man entscheiden kann und muss, was in der jeweiligen Situation praktischer und ökonomischer ist.
Wir haben auch sehr gute Erfahrungen mit Güllebelüftung gemacht, ich kann bestätigen, dass die Gülle nicht mehr stinkt, die Nährstoffe stabilisiert werden und ein wertvoller bioaktiver Dünger entsteht. Allerdings sind nach unserer Kalkulation die Kosten für die Güllebelüftung verhältnismässig hoch. Zudem muss zur Verhinderung von Ammoniakemissionen in der Anfangsphase der Belüftung ein Gülleluftfilter (wir haben einen Pflanzenkohlefilter dafür konstruiert) eingesetzt werden. Für die Umstellung traditioneller Stallanlagen bedeutet dies relativ viel Aufwand.
Bei der Güllefermentierung durch Milchsäurebakterien, wie wir es im Artikel vorschlagen, ist der Mehraufwand sehr gering und es lässt sich in jeder Stallanlage umsetzen. Durch die Milchsäuregärung werden die Clostridien, wie Monika Krüger von der Universität Leipzig nachweisen konnte, desaktiviert und sind nicht mehr fortpflanzungsfähig. Dieses Problem lässt sich also ebenso durch die Fermentierung lösen.
Ansonsten teile ich Deine Position, dass es der Dreh- und Angelpunkt die Humuswirtschaft ist, in die sich die Stallwirtschaft einklinken muss.
Die von Henning Knutzen erwähnten Filme auf seiner Webseite http://www.hamhamgmbh.de geben einen ausgezeichneten Einblick in die Problematik und Technik. Sie anzuschauen, kann ich allen Lesern nur empfehlen.
Besten Dank & Gruss, Hans-Peter
Marko Heckel
09.11.2011 12:05
Hallo Hans-Peter,
Danke, dass Du die Gülle-Problematik ansprichst. Wieder mal den Nagel auf den Kopf getroffen. Das Ziel sind Landwirtschaftsbetriebe, die nicht mehr stinken. Jeder Gestank zeigt Nährstoffverluste, entstehende Giftstoffe und ein Krankheitsmilieu. Gestankfreie Betriebe sind absolut möglich und mit EM und anderen Methoden schon oft erreicht worden.
Ich wußte nicht, dass der wertvolle Sauerkrautsaft in den Mengen entsorgt wird. Da gäbe es viele schöne Anwendungsgebiete. Wie auch immer, das Beste ist, Sauerkrautsaft gleich den Tieren zu füttern. Dann hat man nicht nur gesündere Tiere und bessere Futterverwertung, sondern auch das bessere Stallklima und bessere Gülle.
Ich hatte auch schon mal ein Güllerezept mit Pflanzenkohle, EM usw. zusammengestellt, mit Preisen und allem. Demnächst gibt es auch einen Bericht im EM-Journal dazu siehe hier:
www.triaterra.de/Infoseiten-EM-und-Terra-Preta/Guellebehandlung
Martin Pledl
21.11.2011 15:09
Sehr geehrter Herr Schmidt,
mit großem Interesse habe ich Ihren Artikel "Güllebe-
handlung durch Pflanzenkohle gelesen"
Ihre Ausführungen waren für mich als interessierten
Laien sehr lehrreich.
Überrascht hat mich jedoch Ihr Hinweis, daß Millionen
Liter an Sauerkrautsaft in Kläranlagen kostenpflichtig
entsorgt werden.
Wie kommt das? Ist das Abfall von Konservenfabriken, oder
wie muß man sich das vorstellen ?
Für eine gelegentliche Antwort wäre ich Ihnen dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Martin Pledl
hps
21.11.2011 17:41
... die Entsorgung so riesiger Sauerkrautsaftmengen gehört zu jenen Informationen, auf die auch ich immer wieder mit Entsetzen und Fassungslosigkeit stoße. Es ist der Saft, der bei der Sauerkrautproduktion entsteht und Sauerkraut wird in Mitteleuropa noch immer in großen Mengen hergestellt. Freundlich grüssend, hps
Michael Schläpfer
18.11.2013 15:31
Sehr geehrter Herr Schmid
Interessanter Ansatz ihr Bericht. Ich frage mich aber wie es mit der Vertäglichkeit der behandelten Gülle ausschaut in Bezug auf den Beton, Rührwerk,... da ja die behandelte Gülle recht sauer wird. Silage hat einen PH von 4.7 und es entstehen schon Schäden im Silo. Meine Frage also: Wie Nachhaltig ist eine dauernd stark saure Gülle in Bezug auf die Lebensdauer und Betriebssicherheit eines Beton-Güllenlagers. Ich freue mich auf eine Antwort.
Freundliche Grüsse
hps
20.11.2013 18:08
Sehr geehrter Herr Schläpfer, entscheiden ist nicht nur der eigentliche pH-Wert, sondern die Pufferkapazität. Durch die Steuerung der Fermentierung mit effektiven Mikroorganismen bildet sich in der Güllegrube Milchsäure, die mit Eiweiss gepuffert wird, wodurch der Beton, Rührwerk usw. eher weniger beansprucht werden. Ich muss aber zugeben, dass mich diese Erklärung selbst auch noch nicht richtig befriedigt. Leider kann ich hier nur auf die Erfahrung verweisen, dass durch Güllefermentierung trotz des niedrigeren pH-Wertes die Aggressivität gegenüber dem Beton eher abnimmt. Ich möchte Ihnen gern versprechen, dies in Zukunft näher zu untersuchen und zu hoffen, dass die Kollegen bald mit eine wissenschaftlich fundierten Erklärung aufwarten können.
Ingur Seiler
20.07.2015 17:22
Guten Tag Herr Schmid,
Danke für den Artikel, ich habe ihn erst jetzt gefunden. Wir haben in der Nähe eine Sägerei die neu einen Holzvergaser betreibt. Die anfallende Asche, hat ziemlich viel Kohle drin, ist sie geeignet? Sauerkraut wird bei uns mit Molke geimpft, kann man auch mit Molke die Gülle impfen? Denn wo bekäme ich den Krautsaft her
Wie ist es beim Mist. Das kompostieren ist für unseren Kleinbetrieb eher kompliziert. Kann man ihn auch zur milchsäuregärung bringen? Eventuell durch feucht halten und festtreten?
Vielen Dank
hps
20.07.2015 21:31
Sehr geehrte Frau Seiler, die Holzvergaserkohle würde ich an Ihrer Stelle erst nach einer entsprechenden EBC-Analyse der Kohle einsetzen. Das Risiko zu hoher PAK-Belastungen ist bei dieser auf Energiegewinnung optimierten Technologie sonst zu hoch. Es gibt Beispiele sauberer Holzvergasungstechnologie, deren Pflanzenkohle problemlos eingesetzt werden kann, aber dies muss unbedingt im Vorfeld kontrolliert werden.
Gülle kann man auch mit Molke impfen, ergänzend würde ich aber trotzdem die Anwendung von EM empfehlen. Mist kann ebenso fermentiert werden, am besten direkt im Stall mit Kohle in der Einstreu und EM in der Verneblung.
Schöne Grüsse, hp schmidt
Hannes
01.11.2015 16:36
Hallo Herr Schmidt,
funktioniert die Aufladung der Pflanzenkohle auch mit Jauche? MfG Hannes
hps
01.11.2015 16:49
... es geht auch mit Jauche. Je flüssiger die Nährstofflösung jedoch ist, desto besser können diese in die Poren der Kohle dringen.
Jürgen
25.10.2016 18:19
Frage:Kann man Molke in der Gülle entsorgen,und wieviel maximal?
hps
26.10.2016 06:10
Die Molke ist ein Ferment mit vielen Milliarden Milchsäurebakterien, die bei der Entsorgung in die Gülle neue Nährstoffe bekommen und wieder aktiv werden. Das funktioniert so ähnlich wie bei der Verwendung von Sauerkrautsaft. Es wird also für die Stabilisierung der Gülle helfen und Nährstoffe erhalten. Für den Boden ist Molke ohnehin gut, also gibt es keinen Maximalwert, wie viel Molke der Gülle zugesetzt werden kann. Zu viel kann hier nicht schaden.
Rudolf Overhoff
13.02.2017 10:07
Guten Tag Herr Schmid,
sehr interessanter Artikel zur Güllebehandlung!
Ich bin Landwirt und habe das Problem das die Gülle
stark schäumt. Meine Frage, würde ich die Gülle fermentieren wie von Ihnen beschrieben, damit die Aus-schäumung eindämmen können? (Rindergülle)
hps
13.02.2017 12:59
Sehr geehrter Herr Overhoff,
das Aufschäumen der Gülle kommt vor allem daher, dass zu viel nicht vollständig abgebaute Stärke und andere mikrobiell leichtverfügbare Kohlenstoffquellen in der anaeroben Güllegrube enthalten sind und bakteriell abgebaut werden. Dabei entstehen vor allem Methan und Schwefelwasserstoff, welche als Gas aufsteigen und die viskose Gülle schäumen. Wird hingegen für eine Milchsäurevergärung der Gülle gesorgt, würden jene Methan produzierenden Bakterien unterdrückt und die Stärke würde hauptsächlich zu Milchsäure umgewandelt. Bei der Milchsäuregärung entsteht nur wenig CO2 und kein Methan, womit die Schaumbildung verhindert wird. Andererseits ist das Schäumen aber auch ein Zeichen dafür, dass die Fütterung optimiert werden sollte, so dass weniger unverdaute Stärke in die Grube kommt. Das würde auch den Tieren gut tun.
Mit freundlichen Grüssen, Hans-Peter Schmidt
Jakob Unterhofer
19.04.2017 18:38
Sehr geehrter Herrn Schmidt !
25 Jahre wirtschaften wir in unserer Berglandwirtschaft auf1300 Meter Seehöhe mit Gülle in der Milchwirtschaft. Stets darauf bedacht gestanklose Rottegülle für das Bodenleben am Feld zu produzieren, ist aber trotz verschiedener viel gepriesener Güllezusätze (auch EM)nie gelungen ! Vielleicht könnten sie mir einen wertvollen Hinweis geben, wie man in unserer Lage (Berggebiet) eine wertvolle Rottegülle erzeugen könnte ? Sehr interessieren würde mich auch der Krautsaft,obwohl es ihn in unserer Gegend nicht gibt. In Erwartung ihrer Antwort grüße ich sie freundlich , Jakob aus Südtirol.
hps
22.04.2017 07:37
Sehr geehrter Herr Unterhofer,
Bei der Güllebehandlung kann immer wieder viel schief gehen und dann klappt es mit der geruchlosen Gülle doch wieder nicht. Es gibt allerdings einige Firmen, die nicht nur ein Mittel verkaufen, sondern eine ganze Methode mit Beratung. Sie sollten einen Vertrag mit Erfolgsgarantie schließen, so dass z.B. 50% der Kosten erst fällig werden, wenn die Gülle wirklich nicht mehr stinkt. In Österreich gibt es die Firma Multikraft, in Deutschland EM-Chiembau und in der Schweiz die EM-Schweiz, von denen wir jeweils wissen, dass deren Methode vielerorts klappt.
Anstatt Krautsaft können Sie sich auch ihre eigenen Fermente herstellen. Nehmen Sie 1000 l Wasser, mischen sie 30 kg Zucker dazu, geben sie 300 l frische Blätter und Wissenschnitt dazu und decken es ab. Nach 10 Tagen haben Sie frische Fermente, die sich gut für die Gülle- bzw. die Kohlebehandlung eignen.
Gerade in Berggebieten würde ich statt einer riesigen Güllegrube lieber zwei kleine Gruben (je ca. 1 - 2 m3) vorsehen. Die Grube sollte jeweils mit Pflanzenkohle (einfach im Kon-Tiki selbst hergestellt) gefüllt werden und die Gülle darauf geführt. Ist die eine Grube voll (Kohle schwimmt auf der Gülle auf), wird die weitere Gülle in die andere Grube geleitet. Dann kann die erste Grube mit der Traktorschaufel entleert werden und sie haben den besten Dünger auf Erden, der jederzeit eingebracht werden kann (ohne Gülle-Sperrzeiten). Am besten sollte der Gülle-Pflanzenkohle-Dünger aber so wie im Artikel http://www.ithaka-journal.net/wurzelapplikation und http://www.ithaka-journal.net/biodunger-schlagt-chemie-eine-chance-fur-teebauern-im-himalaya ausgebracht werden.
Viel Erfolg und berichten Sie uns bitte darüber, Hans-Peter Schmidt
Jakob Unterhofer
29.04.2017 06:28
Herrn Schmidt noch eine Frage bitte.
In welche Richtung könnte sich ,nach dem Pflanzenkohle-GülleSystem,auf Dauergrünland der Pflanzenbestand entwickeln ? Gräser bzw.Untergräserreich, oder Kräuter bzw. Unkrautmäßig?
Und bei spontaner Umstellung auf Pflanzenkohle: Mit wieviel kg Pflanzenkohle sollte man den qm Gülle durchmischen, um eine entsprechende Wirkung zu erzielen?
hps
01.05.2017 07:54
In einem Versuch von Prof. Claudia Kammann wurde gezeigt, dass die Mischung aus Pflanzenkohle und Schweinegülle die Biodiversität und das Wachstum von Kräutern und Blumen gegenüber denen von Gräsern stimmulierte und dass es mehr Leguminosen gab (Kammann et al. 2014: https://www.academia.edu/15923103/Changes_in_macro-_and_micronutrient_contents_of_grasses_and_forbs_following_Miscanthus_x_giganteus_feedstock_hydrochar_and_biochar_application_to_temperate_grassland). Dies ist meines Wissens allerdings der einzige Versuch, der die Auswirkung auf die Biodiversität von Weiden zeigte. Es könnte also auf anderen Böden auch andere Ergebnisse geben.
Bezüglich der Mengen gibt es zwei Möglichkeiten:
1) geringe Mengen zur Güllebehandlung: (1-2% (vol) Pflanzenkohle auf die Gülle)
2) Aufladung der Pflanzenkohle mit Nährstoffen mit nachfolgender Wurzelapplikation (http://www.ithaka-journal.net/wurzelapplikation und http://www.ithaka-journal.net/biodunger-schlagt-chemie-eine-chance-fur-teebauern-im-himalaya). Hierfür wird Gülle und Kohle 1:1 (vol) gemischt.
Heribert
01.05.2018 14:45
Sehr geehrter Herr Schmidt,
ich freue mich, daß ich nach langer Recherche auf Ihren Artikel mit den tollen Forumsbeiträgen gestoßen bin, der die Behandlung von Gülle und Stallmist konkret beschreibt. Viele andere, insbesondere die offenbar den Landwirtschaftsverbänden nahestehenden beschäftigen sich nur mit den verschiedenen Arten der Lagerung und Ausbringung.
Jetzt meine Frage:
Mit der Milchsäuregärung wird der Zucker verbraucht, ein saures Milieu geschaffen, das für Fäulnisbakterien ungünstig ist. Ansonsten wird die organische Materie konserviert - so wie beim Sauerkraut. Ein Teil der organischen Materie wird sicherlich zum Aufbau der Milchsäurebakterien benötigt. Aber so viel ist das doch nicht, siehe Beispiel Sauerkraut - oder? Was passiert mit dem Harnstoff, den Eiweißen, der Zellulose, dem Lignin...?
Wenn jetzt der Sauerstoff nach der Ausbringung wieder dazukommt, dann beginnt doch der bis dahin aufgeschobene Fäulnisprozeß - oder? Ein wesentlicher Unterschied zum Ausgangsmaterial ist allerdings, daß es keinen Zucker mehr gibt. Es gibt doch immer noch die N, C und P Kreisläufe, die laufen aber nun anders ab, da die Milchsäuregärung die Stoffe irgendwie transformiert hat, denke ich - aber in was? Wer sind die Player im aeroben Milieu?
Können Sie mir bitte erklären, was denn mit dem organischen Material während und nach er Milchsäuregärung passiert?
hps
03.05.2018 16:24
Sehr geehrter Herr Keilwerth, die Milchsäuregärung ist quasi eine Art Vorverdauung. Die organischen Verbindungen sind bereits teilweise aufgespalten und können von aeroben Mikroorganismen nun leichter verstoffwechselt werden. Es kommt daher zum einen nicht mehr zur Fäulnis und zum anderen zu einer schnelleren Nährstoffverfügbarkeit sowohl für die Mikroorganismen als auch im Anschluss daran für die Pflanzen. Zudem sind 1 bis 5 Milliarden Milchsäurebakterien pro Milliliter zu finden, welche wiederum Nährung für Protozoen, Nematoden, Würmer usw. sind, wobei Stickstoff ausgeschieden wird. In Kurz: durch die Fermentierung kann man die eigentliche Kompostierung dem Boden überlassen, wodurch die bei der Kompostierung freiwerdende Energie dem Boden und nicht nur dem Komposthaufen zugute kommt. Ich hoffe, die vorwiegenden Prozesse in der gebotenen Kürze etwas verständlicher gemacht zu haben. Ich hoffe, wir werden bald einmal einen ausführlichen Artikel zu den Prozessen in Ithaka bringen können. Wir arbeiten ja derzeit an der Co-Vergärung von Pflanzenkohle (ohne Gülle), was sehr interessante Substrate verspricht. Mit freundlichen Grüssen, Hans-Peter Schmidt